Meist angesehen
Kategorien
- Boscher bespricht (13)
- Boscher fragt (14)
- Boscher fragt etwas anderes (6)
- Boscher informiert (11)
- Boschers Buchtrailer (2)
- Boschers Fotos (14)
- Boschers Mixed Pickles (10)
- Boschers Schreibe (35)
- Boschers Streiflichter (56)
-
Besucher auf der Seite
Jetzt online: 0
Gesamt: 633795 -
Neueste Beiträge
- Musik und Literatur – eine Betrachtung
- Warum in die Ferne schweifen… Resturlaub oder der Tourist am eigenen Wohnort – Bodensee-Sightseeing
- Und täglich grüßt der Laubbläser
- Herzlich willkommen auf Boschers Blog, dem Autoren-Blog von Ralf Boscher
- Verdammt! Hätte ich doch nicht aus der Kirche austreten sollen?
- Ich alter Sack und die AfD
- Post von der Bundesregierung – eine schöne Maskerade
Schlagwörter
- Alltagsgeschichten
- Amazon
- Autor
- Blog
- Bodensee
- Buchmarkt
- Buchtrailer
- Buchvorstellung
- ebook
- Erotik
- Facebook Fund
- Fotos
- Gedichte
- Glosse
- Historisches
- Hodenkrebs Erfahrungen
- Horror
- Humor
- Interview
- Katze
- Krebs
- Krimi
- Kurzgeschichten
- Leseproben
- Lesetipp
- Liebe
- Lyrik
- Mordsroman
- Musik
- Männer
- Niederrhein
- Philosophie
- Preisaktion
- Ralf Boscher
- Rezension
- Roman
- Schreiben
- Self-Publishing
- Spannung
- Taschenbuch
- Thriller
- Topik
- Vampirroman
- Weihnachten
- youtube
Neueste Kommentare
- Gesa bei Musik und Literatur – eine Betrachtung
- Selbstklebefolien bei Am Bodensee – Leseprobe aus „Abschied ist ein scharfes Schwert. Ein Mordsroman“
- Max bei Friendly Poison… 1 Zyklus adjuvante PEB Chemotherapie – Hodenkrebs, Erfahrungen und Informationen
- Jonathan bei Friendly Poison… 1 Zyklus adjuvante PEB Chemotherapie – Hodenkrebs, Erfahrungen und Informationen
- Michael bei Ein Blick hinter die Buchstaben… Fragen an den Schriftsteller Béla Bolten
Archiv
- Februar 2024 (1)
- Januar 2024 (1)
- Oktober 2023 (2)
- Februar 2023 (1)
- April 2021 (1)
- Februar 2021 (1)
- April 2020 (1)
- März 2020 (1)
- Dezember 2019 (1)
- November 2017 (1)
- Juni 2017 (1)
- April 2016 (1)
- Februar 2016 (2)
- Dezember 2015 (4)
- November 2015 (2)
- August 2015 (1)
- Juli 2015 (1)
- Juni 2015 (1)
- Mai 2015 (2)
- April 2015 (2)
- März 2015 (2)
- Januar 2015 (1)
- Dezember 2014 (1)
- November 2014 (3)
- Oktober 2014 (6)
- September 2014 (5)
- August 2014 (5)
- Juli 2014 (8)
- Juni 2014 (5)
- Mai 2014 (6)
- April 2014 (7)
- März 2014 (9)
- Februar 2014 (15)
- Januar 2014 (16)
- Dezember 2013 (11)
- November 2013 (14)
- August 2004 (1)
- August 2002 (1)
Schlagwort-Archive: Roman
Architeuthis oder der verstrahlte 48 Meter Riesentintenfisch – Rezension: „Der Rote“ von Bernhard Kegel
Millionenfach über Facebook geliket, von Zeitungen und Fernsehstationen aufgegriffen, etwa von „Der Welt“ unter der Überschrift: „Das Rätsel um den verstrahlten Riesen-Tintenfisch“ (vom 10. Januar 2014): Das zunächst vom Onlineportal „The Lightly Braised Turnip“ verbreitete Bild eines gigantischen, 48 Meter langen Riesentintenfischs an einem Strand von Santa Monica, Kalifornien. Vermutete Ursache der furchterregenden Größe: „radioaktiver Gigantismus“ und die Atomkatastrophe von Fukushima.
Und auch wenn dieses Foto ein Fake ist – dass es solche Giganten der Tiefsee tatsächlich gibt, wird mittlerweile als erwiesen angesehen: „Abdrücke mit etwa fünfzig Zentimeter Durchmesser an gefangenen Pottwalen lassen auf eine Größe der Krake von ungefähr fünfzig Meter schließen“ (Zitat: Ankündigung des Films „Riesenkraken – Monster der Meere“ von Jo Sarsby am 14. Januar 2014 auf Phoenix).
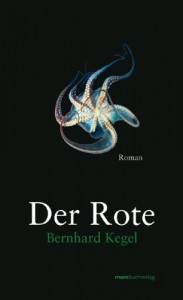
Ein faszinierendes Thema. Die Tiefsee, von der wir weniger wissen als vom Weltraum, und die dort lebenden riesigen Kopffüßer. Eine Faszination, die mich zu Bernhard Kegels Roman „Der Rote“ greifen ließ.
Kennt Ihr den Schwarm? Ich bislang noch nicht (damit befinde ich mich wahrscheinlich in kleiner Gesellschaft, sagen wir mal, von der Größe eine Fußballmannschaft). Jedenfalls hatte das den Vorteil, dass ich Bernhard Kegels Roman „Der Rote“ (gerne beworben im Stil von „Sie fanden den Schwarm toll, dann lesen Sie…“) lesen und schätzen lernen konnte, ohne Schätzing im Kopf.
Nun gut, ganz unvoreingenommen war ich nicht. Aufgrund so mancher Kritik erwartete ich so eine Art Dinopark unter dem Meer gewürzt mit einem guten Schuss Katastrophendrama („Tsunami“), ich dachte (vgl. meine erwähnte Faszination), da lauert etwas Monströses zwischen den Buchdeckeln, ein Kampf der Giganten Riesenkrake (und zwar eine wirklich richtig riesige Riesenkrake, bzw. sogar viele davon) und Pottwalen (auch vielen davon), eine Art maritimer Showdown auf Endzeit-Niveau.
Nun, diese Erwartungshaltung (wahrscheinlich habe ich letzter Zeit auch einfach zu viele Emmerich-Filme gesehen) wurde enttäuscht, zum Glück. Denn „Der Rote“ ist ein wirklich feines Buch rund um die Leidenschaft für glitschige Tiere, die in einer Welt leben, die uns Menschen (noch) nicht offensteht (die Tiefsee), ein spannendes Buch über Wissenschaft und Verantwortung, eine fesselnde Reflexion über Forschung unter dem Zwang, sich auch wirtschaftlich auszahlen zu müssen.
Der Rote ist ein Roman über unser Verhältnis zu Wesen, die uns so fremd sind, dass wir sie nicht verstehen können, deren Andersartigkeit uns entweder Angst oder Respekt einflößt. Natürlich ist „Der Rote“ groß, monströs, natürlich taucht das Motiv des Kampfes zwischen dem größten säugenden Raubtier, dem Pottwal, und den mehrarmigen Giganten öfter auf. Es gibt auch einen Tsunami (wirklich eindrucksvoll erschreckend geschildert, finde ich). Aber gleichwohl bezieht das Buch seinen Reiz doch eher aus den leiseren Momenten. Zum Beispiel die Beschreibungen der Tauchgänge der Hauptfigur Herrman Pauli, ein deutscher Biologe, auf denen er seine Leidenschaft für vielarmigen Wesen der Tiefsee entdeckt. Oder die Momente Auge in Riesenauge mit dem Roten, in denen eine Intelligenz glänzt, die nicht menschlich, aber sehr respektabel ist.
Wie gesagt, ein sehr lesenswertes Buch (mit einem Schuss Liebesroman), spannend, faszinierend in seinem faktenreichen Detailreichtum (ohne referierend zu wirken, meist). Ach ja, eigentlich geht es auch gar nicht um Riesenkraken, sondern um Kalmare (Architeuthis und Kolosskalmar).
Quellen:
The Lightly Braised Turnip
Die Welt
Phoenix
Veröffentlicht unter Boscher bespricht
Verschlagwortet mit Lesetipp, Rezension, Roman
Schreib einen Kommentar
Ruhe im Kartong oder: WG-Leben kann so grausam sein

Ja, ich muss zugegeben, dass ich mir zu dieser Zeit ein wenig Sorgen um mein sonniges Wesen machte. Die Tabletten, welche ich gegen meine Rückschmerzen schluckte, machten es wahrscheinlich auch nicht besser. Zu allem Überfluss erhielt ich zwei meiner Manuskripte von Verlagen dankend zurück, womit ich nun überhaupt nicht gerechnet hatte, war ich doch davon ausgegangen, dass ich mir den Verlag würde aussuchen können. Und Udo, ja Udo trieb es in diesen Tagen, da ich bei den Frauen kein Glück hatte, wie ein Wahnsinniger bei uns in der WG. Ausgerechnet Udo, um den doch die Frauen sonst immer einen solchen Bogen machen, wie er mit seiner Matte um den Friseur. Und wenn ich in der WG schreibe, dann meine ich auch in der WG.
Es musste doch wirklich nicht der Kühlschrank sein, und gerade zu der Zeit, da ich zumeist – wie Udo es doch mittlerweile wissen müsste – von der Arbeit nach Hause komme und gerne noch ein letztes Bier in der Küche trinke. Also, das Letzte, was ich in einer solchen Nacht noch sehen möchte, ist Udos Arsch, eingerahmt von zwei Beinen, die in der Luft hängen, untermalt von einem geradezu obszönen, so lauten Klatschen, dass ich dies eigentlich schon – wenn ich nicht so müde gewesen wäre – im Flur hätte hören müssen. Mal ganz abgesehen von Udos angestrengtem Keuchen, dem Geklirre und Geschepper im Kühlschrank und der hörbaren Freude von Udos Bekanntschaft an dieser ganzen Aktion. Als hätte dies noch nicht gereicht, schäumte mein Bier zudem über, das ich mir dann – als die Küche wieder frei war – genehmigen wollte.
Als ich Udo am nächsten Tag darauf ansprach, zuckte er nur mit den Achseln. War ihm wohl zu Kopf gestiegen, auch mal was mit einer Frau zu haben. Zugegeben, diese Frau nahm ihn ganz schön ran, der Küchenszene folgte schon bald heftigstes Treiben in der Dusche, aber muss man sich denn gleich seinen ganzen Anstand aus dem Hirn ficken? Schließlich hatte ich mein Zimmer direkt neben dem Bad, und dieses Gekicher, lauthalse Lachen, dieses ganze Geplätscher, und schließlich dieses beständige Rumsen gegen die Wand, mal schneller, mal langsamer, in solch einem unberechenbaren Rhythmus, dass es einfach nicht zu ignorieren war, zumal diese Frau irgendwann begann, Udo lautstark anzufeuern: Ja ja, pack mich, tiefer, schneller, höher, weiter, weiter, meine Muschi, mein Arsch, meine Titten! Fehlte nur noch, dass Udo auch noch anfing: Mein Schwanz, mein Arsch, meine Eier. Ich kann Ihnen sagen, Udos Ausdauer ging mir ganz schön an die Nieren, man will ja auch mal schlafen. Aber das interessierte ihn, wie gesagt, nicht die Bohne, er zuckte nur mit den Achseln, meinte, man muss die Feste feiern, wie sie fallen, griff sich zwei Tassen Kaffee, und wie ich dann am steigenden Geräuschpegel aus seinem Zimmer hören konnte, ließ es sich seine Bekannte schon wieder gefallen, feste gefeiert zu werden. Tja, so sah es aus, und dergestalt ging das Tage weiter. Zwischenzeitlich tauchte Gerd wieder auf, der einige Zeit unterwegs gewesen war, und selbst ihm, der gerne beobachtend an den Vergnügungen anderer Menschen teilnimmt, reichte es bald. »Als ich gestern nach Hause kam, ließ sich die Wohnungstür einfach nicht öffnen«, meinte er eines Morgens, sichtbar genervt und übermüdet zu mir, »nur einen Spalt bekam ich sie auf, und dann hörte ich sie auch schon wieder, ich hörte es schmatzen und leise stöhnen, sie standen direkt an der Tür, ich spürte es, als ich gegen sie drückte, und meinst du, sie hätten aufgehört, ‘Moment noch!’ meinte Udo nur. Ich dachte, ich spinn’. Der hat überhaupt keine Hemmungen mehr, ‘Schneller!’ sagte er dann noch zu ihr. Eine geschlagene Zigarettenlänge stand ich da wie ein Depp vor der Tür, bis Udo mich mit so einem blöden Grinsen reinließ.«
Wahrlich die Stimmung bei uns in der WG kochte hoch. Um das Fass vollzumachen, hatte Gerd, als er unterwegs gewesen war, auch eine Frau kennengelernt, und da sie mehrere Hundert Kilometer entfernt in Konstanz am Bodensee lebte, blockierte er ständig das Telefon. Außerdem bewies er das Fingerspitzengefühl eines Bulldozers: »Wie geht’s denn so mit dir und Carmen?«, fragte er mich, »Siehst du sie hier irgendwo?«, gab ich kurz angebunden zurück und dachte, damit hätte ich Ruhe. Er aber sah sich wirklich um, zuckte dann mit den Schultern: »Nein! Und was ist mit deinem Roman?« Ich ließ ihn stehen, mit ihm darüber zu reden, das von den Manuskripten, die ich kurz nach der Vollendung meines Werkes an Verlage gesandt hatte, nahezu jeden Tag eines zu mir zurückkehrte, hatte ich nun wirklich nicht das geringste Bedürfnis.
Kurz gesagt also: Es war wirklich Zeit, sich mal wieder zusammenzusetzen und ein bisschen etwas für ein besseres Klima bei uns in der WG zu tun: am besten Skatspielen (für eine Runde Doppelkopf waren wir, seit Diana nicht mehr unter uns weilte, zu wenig Spieler), denn das hatte bislang bei Unstimmigkeiten immer geholfen. Und so zockten wir dann ein paar Tage später, als ich einen freien Abend hatte, Gerd nicht dringend telefonieren musste und Udo, da seine Freundin mal etwas anderes unternahm, seinen Schwanz in der Hose lassen konnte, eine Partie Skat.
Zunächst ging alles gut. Wir spielten Runde um Runde, arbeiteten uns an dem Kasten Bier, den ich besorgt hatte, ordentlich ab und qualmten die Bude voll. Abgesehen davon, dass keiner von uns das heikle Thema Frauen ansprach, ein ganz normaler Abend unter Männern. Doch dann schwankte Gerd auf die Toilette, und Udo hatte plötzlich diese Anwandlung, unbedingt doch einmal in diesen Topf hineinschauen zu müssen, der schon des längeren unberührt auf unserem Herd gestanden hatte.
Mir hätte ja sein Gesicht, als er den Deckel hob, vollends gereicht, hätte mir den Inhalt gar nicht zeigen brauchen. Was immer es mal gewesen sein mag, es stank nicht nur, es bewegte sich auch. Vielleicht sogar schneller als Gerd. Denn als Udo ihm – kaum dass er von der Toilette kam – den Topf wortlos unter die Nase hielt (es war einfach klar, dass diese Sauerei von Gerd stammte), da schien es zwar so, als würden Gerds Hände den Topf umfassen, ja, zumindest fassten sie, als Udo ihn losließ, zum Topf, aber eben nicht schnell genug. Vielleicht hatte er sich auf Toilette ja auch einfach nur nicht gründlich genug die nassen Hände abgetrocknet, so dass er noch Seife an den Fingern hatte, jedenfalls sauste ihm der Topf durch die Finger und schlug geradezu spektakulär auf dem Boden auf. Erst schepperte es, dann spratzte es auch mächtig. Was immer es mal gewesen sein mag, jetzt bedeckte es großflächig unseren Küchenboden oder versuchte in den Ritzen der Fliesen zu verduften. Und dann ging alles sehr schnell.
Udo musste lachen, und ich konnte endlich mal wieder lachen, hatte ja schon fast geglaubt, ich wäre der Einzige unter Gottes weitem Himmel, dem Missgeschicke geschehen würden. Gerd lachte nicht. Dafür ging er hoch wie eine Rakete, von langsamen Bewegungen plötzlich keine Spur mehr: »Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich das wegmache!« schrie er. Blitzschnell hatte er kombiniert, denn natürlich glaubten wir dies. Statt einer, oder wie er es wohl aufnahm, als Antwort mussten wir noch mehr lachen, woraufhin er äußerst behende einen Stuhl nahm und vor die Wand warf, was uns dazu brachte, wenigstens zu versuchen, unseren Heiterkeitsausbruch zu unterdrücken, weil es jetzt offensichtlich Ernst wurde. Ich schaffte es sogar ganz gut – der ganze Frust der letzten Zeit war ein ordentliches Gegengewicht gegen Heiterkeit –, stand auf und sagte recht ruhig zu Gerd: »Natürlich machst du das weg, es ist dein Scheiß!« Dann aber musste ich doch kichern, was meine Autorität beträchtlich untergrub, und noch mehr untergrub diese mein auf Gerds Worte: »Ich hab den Scheiß aber nicht hingeworfen!« folgendes Lachen, was jenen dazu brachte, sich den Besen zu greifen und mit diesem drohend auf mich loszugehen: »Hör auf zu lachen, du Arsch!«, schrie Gerd, »Ich mach mich doch hier nicht vor euch zum Affen!« schrie er und hob den Besen über seinen Kopf.
Das hätte er wohl besser nicht getan, immerhin hatte Gerd einen Mann vor sich, dem in der letzten Zeit einiges aus dem Ruder gelaufen war. Aber um des lieben Friedens willen verzog ich mich – immer noch lachend – Richtung Tür. Hatte mir wirklich vorgenommen, jedem Streit aus dem Weg zu gehen, schließlich ging es um die gute Stimmung in der WG. Aber irgendwas in der Art wie Na, dann mach mal schön! habe ich mir dann doch wohl, den Türgriff schon in der Hand, nicht verkneifen können.
Ich hätte die Tür garantiert nicht mehr auf- und vor allem hinter mir zubekommen, so schnell stürzte Gerd brüllend wie ein kompletter Wikingerhaufen beim Angriff auf mich zu. Er hob den Besen, »AaaaaaHHHH!« schrie er, machte einen letzten, langen Schritt: »Aaahhh!« und rutschte auf all dem Scheiß, der den Boden bedeckte, aus. Der Besen flog, seine Arme flogen, seine Beine, und s p r a t z landete Gerd auf dem Rücken mitten im Was immer es gewesen sein mag. So nahmen die Dinge, die nun wahrlich nicht mehr in ihrem rechten Verhältnis zueinanderstanden, ihren Lauf.
Udo konnte sich vor Lachen kaum mehr auf dem Stuhl halten, war richtiggehend am Headbangen vor Schadenfreude. Gerd rappelte sich mit vor wilder Wut verzerrtem Gesicht wieder auf. Ich verließ derweil getreu meiner einmal gefassten Maxime Kein Streit! die Küche. Kaum dass ich im Flur war, hörte ich schon den nächsten Stuhl poltern, Gerd schrie: »Hör bloß auf zu lachen!«, aber Udo lachte weiter, lachte gar noch lauter, dann erneutes Poltern, Gläser splitterten, das war dann wohl der Tisch gewesen, und dann Udos Stimme – nun ohne Lachen: »Wag‘ es nicht!« In diesem Augenblick schwang die Wohnungstür auf und zu allem Überfluss betrat Udos Freundin den Flur, und nun konnte auch ich nicht mehr an mich halten, hatte Udo ihr doch offenbar einen Schlüssel gegeben, ohne es abzusprechen: »Heut’ wird nicht gefickt!« warf ich ihr also, meinen guten Vorsatz über Bord werfend, an den hübschen Kopf (Geschmack hatte er ja, der Udo). Doch da krachte plötzlich Udo mitsamt der Küchentür, die aus den Angeln gerissen wurde, in den Flur hinein. »Oh Gottogott!«, stöhnte nun seine Freundin (das kannte ich schon aus einem in anderen Zusammenhang), doch Gerd, der augenscheinlich in seiner Wut Wahnsinnskräfte entwickelt hatte, schrie sie aus der Küche heraus nieder: »Du gehst mir nicht mehr auf den Sack!« Währenddessen versuchte Udo, unterstützt von seiner Freundin und vielen »Ohgottogott!«, sich aufzurappeln, doch da kam auch schon Gerd wie eine der sieben Plagen über sie: »Ah, das trifft sich gut!« meinte er nur und hieb mit dem Besen auf sie beide ein. Schließlich aber bekam Udo eines von Gerds Beinen zu fassen und riss ihn um, was dann damit endete, dass Udo, seine Freundin und Gerd unter einigem Gebrüll und vielen »Ohgottogott!« in wildem Herumgeringe aufeinander einprügelten, bis ich von all dem Theater genug hatte, den lieben Frieden endgültig lieben Frieden sein ließ, mich – nachdem ich kurz noch einen Blick in die demolierte Küche geworfen hatte – einmischte und die Streithälse trennte. Und nun endlich war – wie man am Niederrhein so sagt – Ruhe im Kartong.
Dachte ich. Denn am Morgen nach dem einschneidenden Skatabend kehrte Carmen mit Macht zurück. […]
Ende
Dies war eine Leseprobe (eine Szene des sechsten Kapitels „Das Ende vom Lied“) aus: Abschied ist ein scharfes Schwert. Ein Mordsroman von Ralf Boscher. Erhältlich als Taschenbuch und eBook (das eBook noch für kurze Zeit für 2,99 Euro).
Liebe, Lust und Leichen im Keller. Leben und Sterben zwischen Nietzsche, dem Niederrhein und der Müllverbrennungsanlage in Wuppertal, in einer Nebenrolle: die Imperia in Konstanz außer Rand und Band.
„Abschied ist ein scharfes Schwert“ ist ein ungewöhnlich erzählter, an Ironie reicher Mordsroman über einen Schriftsteller und einen Fan, über Gewalt und Gier, Tod und Wiederauferstehung. Ein Buch, das in vielen Genres wildert.
Veröffentlicht unter Boschers Schreibe
Verschlagwortet mit ebook, Erotik, Humor, Krimi, Mordsroman, Roman, Spannung
Schreib einen Kommentar
Dendritenflipper – eine Szene mit Lichterblinken und Pling
Alex Unbehagen stieg mit jeder Stufe, die er im Hausflur hinabging, und plötzlich, auf dem Fuß der Treppe, hatte Alex die Frage. Und nur einen Schritt weiter hatte er auch die Antwort.
Wann hatte Helen eigentlich den Unfall? so lautete die drängende Frage, und sie ging zusammen mit dem bohrenden Unbehagen in genau der Antwort auf, die er am wenigsten hören wollte: An dem Abend, an dem ich sie abgekanzelt habe! Er schlug die Tür des alten Audi zu, drückte die Zigarette aus, startete, gab Gas und KLACK! schoss er los. Sein schlechtes Gewissen katapultierte ihn in einen ganzen Apparat von Schuldgefühlen. Dendritenflipper: Überall blinkten Lichter, und PLING! stieß ihn das Vonsichselbstenttäuschtsein durch den Raum, durch den er, konfus sich um alles andere als um seine Achse drehend, raste.
Er knallte vor das ZU SPÄT! und das BRÜLLEN des Schaffners ertönte wieder: ABGELAUFEN! Abgelaufen! dröhnte es in Alex Ohren, während eine Art magnetischer Sog ihn auf der Stelle festhielt. Abrupt hörte das Dröhnen auf, Farben wechselten rasend schnell und der Sog löste sich. Alex bekam einen Schlag von hinten und schoss wieder quer durch den Flipper. AN DEM ABEND, DA ICH SIE ABGEKANZELT HABE! sang quäkend eine etwas leiernde Automatenstimme und bei: ICH HAB‘ ES NOCH NICHT MAL GEWUSST! gab es ein Freispiel.
Das gab einen Haufen Punkte, und er fuhr in einem Aufzug, die Wände verspiegelt, mehrfaches, dutzendfaches Bild des KLEINEN, SCHWACHEN, DICKLICHEN JUNGEN, in die zweite Etage des Apparates hinauf. Das Spiel hier nannte sich: DU HÄTTEST BEI IHR SEIN SOLLEN! und kaleidoskopmäßig gebrochen jagten Erinnerungsfetzen durch sein Hirn, Frustfetzen, Selbstekelschnipsel, und eine altbekannte Stimme heizte dieses kreisende, sich so verdichtende Depressionsmosaik noch an: MACH DICH DOCH EINFACH WEG! Bei: SIE WOLLTE NICHT BEGRABEN WERDEN! bekam Alex wieder einen Schlag und weiter ging es, begleitet von der altbekannten Stimme, wieder hinunter in die erste Etage: AN DEM ABEND, DA ICH SIE ABGEKANZELT HABE! sang hier die müde leiernde Automatenstimme noch ein paar Takte, und der Schaffner brüllte noch einmal: ABGELAUFEN! dazwischen; dann färbte sich die Welt rot, und Alex knallte vor das ZU SPÄT! Er hatte eine Ampel übersehen und war auf ein anderes Auto geprallt.
Ende der Leseprobe. Entnommen dem Kapitel “Teufel im Leib” aus Ralf Boschers Roman “Engel spucken nicht in Büsche: Roman über Liebe, Tod und Teufel”.
“Engel spucken nicht in Büsche” – ein Krimi. Ein Roman über den Verlust der Unschuld. Erotisch. Hart. Zärtlich. Schonungslos. Ein spannendes Buch über Hoffnung und Schmerz, über Liebe, Leid und Lust.
Veröffentlicht unter Boschers Schreibe
Verschlagwortet mit Krimi, Leseproben, Liebe, Roman
Schreib einen Kommentar
Eine Menage á trois, weißes Pulver und The Doors – neue Leseprobe aus „Abschied ist ein scharfes Schwert. Ein Mordsroman“
 „Johanna war Erstsemester Philosophie, hatte aber zuvor schon einige Semester Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich lernte sie in der Cafeteria kennen, wo sie bei einer Zigarette über dem kommentierten Vorlesungsverzeichnis Philosophie saß, und sich, wie sie es ausdrückte, ansah und anstrich, was sie sich dann doch nicht ansehen würde. Sie machte einen etwas verlorenen Eindruck auf mich. Das Einzige, was sie sicher wusste, schien zu sein, dass sie Zeit bräuchte, um sich zu entscheiden, was sie denn jetzt aus ihrem Leben machen wollte (deswegen auch Philosophie als Fach, nicht da die Philosophen sich mit Lebenszielen auskennen würden, sondern da das Fach so strukturiert war, dass es einem die Zeit ließ, diese Frage wenn schon nicht zu beantworten, dann doch zu stellen). Und was sie noch sicher wusste, war, dass sie eine feste Liebesbeziehung wollte. »Bin halt hoffnungslos romantisch«, meinte sie, »Glaube halt daran, dass es jemanden da draußen gibt, einen mir vorbestimmten Jemand, mit dem ich mein Leben teilen und alt werden will.« Ob mit Männlein oder Weiblein, war dann schon wieder unsicheres, den gängigen romantischen Vorstellungen nicht entsprechendes Terrain. Als ich meinte, na, wenn bei mir auch manchmal alles zu schwimmen scheint, das wenigstens sei mir klar, schaute sie mich fragend an: »Du sagst das so sicher. Noch nie einen Typen getroffen, der dich anzog? Noch nie dieses Kribbeln gespürt, wenn die Grenzen, die einem so mühsam anerzogen wurden, zu zerfließen scheinen?« Nein, sagte ich, ich könne mir halt nicht vorstellen, einen Mann zu küssen, und dann vielleicht noch einen mit Bart. »Aber das jemand dich küsst, dich Mann mit Dreitagebart, das kannst du dir schon vorstellen?«, meinte sie schnippisch. Und dann meinte sie noch: »Stell’ dir doch nur mal vor, wie viele neue Möglichkeiten sich da für dich ergeben würden. So rein quantitativ!« Typisch Wirtschaftswissenschaftler, erwiderte ich, immer den Mehrwert im Kopf, vor lauter Quantitäten völlig die Qualität aus den Augen verlierend.
„Johanna war Erstsemester Philosophie, hatte aber zuvor schon einige Semester Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich lernte sie in der Cafeteria kennen, wo sie bei einer Zigarette über dem kommentierten Vorlesungsverzeichnis Philosophie saß, und sich, wie sie es ausdrückte, ansah und anstrich, was sie sich dann doch nicht ansehen würde. Sie machte einen etwas verlorenen Eindruck auf mich. Das Einzige, was sie sicher wusste, schien zu sein, dass sie Zeit bräuchte, um sich zu entscheiden, was sie denn jetzt aus ihrem Leben machen wollte (deswegen auch Philosophie als Fach, nicht da die Philosophen sich mit Lebenszielen auskennen würden, sondern da das Fach so strukturiert war, dass es einem die Zeit ließ, diese Frage wenn schon nicht zu beantworten, dann doch zu stellen). Und was sie noch sicher wusste, war, dass sie eine feste Liebesbeziehung wollte. »Bin halt hoffnungslos romantisch«, meinte sie, »Glaube halt daran, dass es jemanden da draußen gibt, einen mir vorbestimmten Jemand, mit dem ich mein Leben teilen und alt werden will.« Ob mit Männlein oder Weiblein, war dann schon wieder unsicheres, den gängigen romantischen Vorstellungen nicht entsprechendes Terrain. Als ich meinte, na, wenn bei mir auch manchmal alles zu schwimmen scheint, das wenigstens sei mir klar, schaute sie mich fragend an: »Du sagst das so sicher. Noch nie einen Typen getroffen, der dich anzog? Noch nie dieses Kribbeln gespürt, wenn die Grenzen, die einem so mühsam anerzogen wurden, zu zerfließen scheinen?« Nein, sagte ich, ich könne mir halt nicht vorstellen, einen Mann zu küssen, und dann vielleicht noch einen mit Bart. »Aber das jemand dich küsst, dich Mann mit Dreitagebart, das kannst du dir schon vorstellen?«, meinte sie schnippisch. Und dann meinte sie noch: »Stell’ dir doch nur mal vor, wie viele neue Möglichkeiten sich da für dich ergeben würden. So rein quantitativ!« Typisch Wirtschaftswissenschaftler, erwiderte ich, immer den Mehrwert im Kopf, vor lauter Quantitäten völlig die Qualität aus den Augen verlierend.
Aber auch wenn Johanna mir dann mit geradezu missionarischem Eifer von einer menage á trois erzählte und die Zahlenverhältnisse nun wirklich, was die Möglichkeiten intimer Zwischenmenschlichkeit anging, auf ihrer Seite waren, schien sie mir trotzdem keinen sonderlich erfüllten Eindruck zu machen. Was ich ihr dann auch sagte. »Ja, an manchen Tagen«, seufzte sie übertrieben theatralisch, »da liegt’s einem einfach auf der Seele. Da macht’s keinen Unterschied, ob der Heuhaufen nun zwei Meter oder vier Meter hoch ist, die Sehnsucht, die Nadel zu finden, ist die Gleiche.«
Eine Zeit lang trafen wir uns oft in der Cafeteria, zufällig, wobei ich dem Zufall ein wenig auf die Sprünge half, indem ich mehrmals am Tag der Cafeteria einen Besuch abstattete und nach Johanna Ausschau hielt. Und dann endlich fragte sie mich, ob ich vielleicht am Abend mit ihr ausgehen wolle. Sie würde mich abholen.
Zur verabredeten Zeit saß ich an meinem Schreibtisch über meinem Manuskript, ein Glas Rotwein neben mir und harrte der Dinge, die da kommen mögen. Und was kam, war nicht nur Johanna, sondern ebenfalls eine Freundin von ihr. Wie sich herausstellen sollte, eine sehr gute Freundin von ihr. Ich hatte das Klingeln absichtlich überhört, war so vertieft in mein Manuskript, dass Udo ihnen aufmachen musste. Als die beiden Hand in Hand mein Zimmer betraten, geschah dies genau in dem Augenblick, da ich die Seite aus meiner Schreibmaschine riss, zerknüddelte und in Richtung der Bücher warf, die ich als vorbereitende Lektüre für meine Hauptfigur benutzte und die ich dekorativ um mein Sofa herum drapiert hatte. Johannas Freundin meinte gleich: »Der Künstler am Werk!«, und als ich aufstand, ihnen entgegenkam und sagte: »Na, ein Werk soll es noch werden, jetzt ist es vielleicht nur ein Werkchen!«, war das Eis gleich gebrochen.
Wir fuhren dann zum RPL, dem Rockpommels Land. Raphaela saß am Steuer und Johanna neben ihr auf dem Beifahrersitz. Eine Flasche Rotwein kreiste, geht ja fast immer nur gerade aus auf der B7 Richtung Gevelsberg, aus dem Kassettenrekorder dröhnte, uns auf die erwartete Musik einstimmend, Led Zeppelin, Johannas Kassette, am Vortag aufgenommen. Since i’ve been loving you, dreimal hintereinander, dann viermal Babe i’m gonna leave you. »Heuhaufen-Stimmung?!«, schrie ich nach vorne und stupste ihr mit einem Finger in die Seite (was so viel bedeuten sollte, wie: Schau her, hier bin ich doch, die Nadel!), woraufhin Johanna mich, sich mit ihrem Oberkörper zwischen den Sitzen nach hinten zwängend (sie fuhr ohne Gurt), am Nacken packte, mich doch wahrhaftig auf den Mund küsste, dabei sogar mit ihrer Zunge meine Lippen berührte, und ebenfalls schrie: »Ja, und Grenzenverwisch-Stimmung!«. Na, dachte ich, das kann ja was geben.
Und es gab etwas. Etwas, was es, bei aller Liebe für Johanna, bestimmt nicht gegeben hätte, wenn sie mich nicht so betrunken gemacht hätten. Ich sage es mal so. Johanna war mit ihrer Mission, meine Möglichkeiten quantitativ (und wie ich es empfand, vor allem qualitativ) zu erweitern, in dieser Nacht erfolgreich. Denn die Nacht, die wir zu dritt begonnen hatten, endete in Raphaelas Altbauwohnung zu viert.
Raphaela war erstaunlich. Wenn ich nicht schon ein Auge auf Johanna geworfen gehabt hätte, dann wäre es gut möglich gewesen, dass ich mich in sie verguckt hätte. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die bei den ruhigen Parts eines Rockstücks so aus den Hüften heraustanzte, um dann bei den härteren Stellen förmlich zu explodieren. Ich und Johanna standen an der Tanzfläche, mit dem Rücken zur Theke (wo sie einen Gin-Tonic nach dem nächsten orderte und bezahlte) und beobachteten sie, beziehungsweise, ich beobachte vor allem Johanna, wie sie Raphaela beobachtete, und wenn ich ein Blitzen in ihren Augen sah, dann sah ich auf die Tanzfläche, wo ihre Freundin umringt von lauter gestandenen Rockern und rockbegeisterten Studenten ihre Hüften schwang. Zwischendurch tanzten auch wir, ich und Johanna, wobei es mir sehr angenehm den Rücken herunter kribbelte, dass sie mich dabei fortwährend ansah, mich manchmal in ihre Arme nahm, ihren Unterleib gegen meinen schwingen ließ, und mir ins Ohr sang, wobei sie ein ums andere Mal mit ihrer Zunge meine Ohrmuschel liebkoste.
Das tat sie auch später in dieser Nacht noch einmal, da alles gelaufen war und wir auf Raphaelas breitem Bett lagen, rauchten und ich mühsam versuchte, mir darüber klar zu werden, was denn da eigentlich geschehen war. »Und war es so schlimm? Jetzt hast du jedenfalls Stoff für deinen Roman!«, meinte sie leise, um die beiden anderen nicht zu wecken, und das Lächeln in ihrer Stimme war nicht zu überhören, als sie dann noch sagte: »Ich habe Raphaela extra gebeten, uns einen Kerl auszusuchen, der glatt rasiert ist!«
»Ja!«, meinte ich, nur mühsam meine Beherrschung behaltend, da mir bei ihren Worten schlagartig klar wurde, dass ich nicht die von ihr gesuchte Nadel im Heuhaufen war, sondern nur jemand, mit dem man sich nett die Zeit im Heu vertreiben konnte, bis man irgendwann auf eben jene Nadel stieß, »Ja, Haare auf den Zähnen hat er jedenfalls keine gehabt!« Gleichwohl dachte ich, dass ich diesen Typ so ganz spontan doch gerne um einiges gründlicher rasieren würde, als es einem Mann lieb sein kann…
Nun gut, er konnte nichts dafür, dass ich auf Johannas linkes Spiel hereingefallen war. Gezwungen mitzuspielen hat mich ja schließlich auch keiner. Es sei denn, man wollte diesen unwiderstehlichen Drang, den ich verspürte, nicht lange, nachdem wir zu viert Raphaelas Wohnzimmer betreten und uns über eine Flasche Jack Daniels hergemacht hatten, und Johanna begann, zu tanzen und sich dabei ihrer Wäsche zu entledigen… Also, es sei denn man wollte diesen Drang, den ich spürte, als ich ihre großen Brüste in weichem Kerzenlicht zur lauten Musik von Guns N’ Roses (Welcome to the jungle) wippen sah und neben mir auf dem Sofa Raphaela sich über den Schoß ihres neuen Bekannten gebeugt daran machte, jenem zu zeigen, dass sie nicht nur die richtige Bewegung der Hüften drauf hat… Ja, es sei denn, man interpretiert dieses Gefühl, das mich aufstehen ließ, als Johanna sich – mich anlachend – Whiskey über ihre Brüste goss, bis sie golden schimmerten, ja, das mich aufstehen und schließlich an Johannas Brüsten lecken und saugen ließ, während ich aus den Augenwinkeln sah, dass es nun an dem Kerl war, der auf dem Sofa ausgestreckten Raphaela zu zeigen, dass auch er die richtigen Bewegungen kannte… Ja, es sei, man nimmt an, dass dieser Drang, der Spur des Whiskeys zu Johannas nacktem Bauch hinab zu folgen, etwas so Zwanghaftes an sich gehabt hätte, dass ich nicht anders konnte, als Johanna Folge zu leisten, da sie mir bedeutete, dieses weiße Pulver, das sie sich selbst unter die Zunge massierte, von ihren feuchten Brustwarzen zu lecken.
Nein, gezwungen hat mich niemand, mich ebenfalls auszuziehen und stillstehen zu bleiben, als dann Raphaela – zugegeben, berückend unberockt – zu Johanna und mir trat, während dieser Kerl, die Hose um die Knie baumelnd, zur Anlage stolperte, um neue Musik aufzulegen. Lächelnd hielt ich still, als Raphaela ihre Finger in die Haare der mittlerweile vor mir knienden Johanna grub und sie mit sanfter Gewalt zu sich hochzog. Raphaela schlang ihr Arme um Johannas nackte Hüften und die beiden küssten sich leidenschaftlich, während aus den Boxen jetzt die Live-Version von Light my fire schallte, was ebenso abgeschmackt wie passend war, und mir eine Hand, nein, zwei Hände das Gefühl gaben, ein Teil dieses Kusses zu sein. Dieses Kusses, an dem dann auch meine Lippen und meine Zunge Anteil nahmen, bis es an Johanna war, nun ihrer Freundin in die Haare zu fassen und jener die Richtung zu zeigen, in die sie nun zu gehen hatte, den Weg, den bereits eine ihrer Hände vorangegangen war, und an dessen Ende ich in lächelnder, stiller Erwartung wartend stand. Ich hätte Nein! sagen können, als Johanna das weiße Pulver nahm, mich damit betupfte, und Raphaela die Anweisung gab, es abzulecken. Selbst wenn ich es vielleicht nicht sofort gesehen und gespürt hätte, was Johanna mit mir und an mir und durch mich tat, hätte ich immer noch Nein! sagen können, als auch Johanna sich vor mich hinkniete und sich mit Raphaela beim Tupfen und Lecken abwechselte, als plötzlich dieser Kerl neben mir stand, und sich das Betupfen und Lecken auf ihn ausdehnte, als The End begann, und sie zu dritt vor mir knieten, als…
Nun, Schwamm drüber, ein paar Tage danach war all das nicht mehr wichtig, denn ich lernte Magdalena kennen, und dann hatte ich ihn endlich, meinen Mörder, und Johanna und Raphaela und der Kerl waren nur noch Futter für meine Bestie.“
Ende der Leseprobe aus: Abschied ist ein scharfes Schwert. Ein Mordsroman von Ralf Boscher. Der Roman ist als eBook und als Taschenbuch bei Amazon erhältlich.
Liebe, Lust und Leichen im Keller. Leben und Sterben zwischen Nietzsche, dem Niederrhein und der Müllverbrennungsanlage in Wuppertal, in einer Nebenrolle: die Imperia in Konstanz außer Rand und Band.
„Abschied ist ein scharfes Schwert“ ist ein ungewöhnlich erzählter, an Ironie reicher Mordsroman über einen Schriftsteller und einen Fan, über Gewalt und Gier, Tod und Wiederauferstehung. Ein Buch, das in vielen Genres wildert.
Veröffentlicht unter Boschers Schreibe
Verschlagwortet mit Erotik, Krimi, Leseproben, Mordsroman, Musik, Ralf Boscher, Roman, Spannung
Schreib einen Kommentar
Winzkriecher – Deleted Scene aus „Engel spucken nicht in Büsche. Roman über Liebe, Tod und Teufel“
Nackt setzte er sich auf die kalte Klobrille, stützte seine Hände auf seine Oberschenkel und betrachtete sich in dieser Pose lange in dem Spiegel, den er vor geraumer Zeit direkt davor an die Wand geschraubt hatte. Stolz tastete er mit den Augen seinen flachen, muskulösen Bauch ab, dem man das gerade verzehrte üppige Mahl nicht ansah. Dann spannte er seine Brustmuskulatur ein wenig an, und darüber vergaß er fast seinen Stuhlgang. Aber auch nur fast. Schließlich ließ er von seinen Betrachtungen ab und konzentrierte sich auf die Kontraktion der Enddarmmuskulatur und die Erschlaffung seines Schließmuskels bei gleichzeitiger Betätigung der Bauchpresse: neben schweißtreibendem Training und gutem Essen gehörte eben auch ausgiebiger, gesunder Stuhlgang zu einem gelungenen Tag.
Mit Grausen dachte er an die Erlebnisse seiner bisher einzigen Urlaubsreise zurück. Dabei hatte er sich damals noch nicht einmal weit von der Heimat entfernt: Frankreich. Aber wenn diese wenigen hundert Kilometer schon genügten, ihm eine seiner Lebensgrundlagen quasi unter dem Hintern wegzuziehen, dann war dieses eine Mal bereits viel zu weit gewesen.
Die erste französische Toilette hatte er zunächst erleichtert registriert, war sie doch an der Nationalstraße, auf der er fuhr, überhaupt vorhanden. Dann jedoch ‑ er hatte mit vorsorglich mitgebrachtem Toilettenpapier in der Hand die Klotür geöffnet ‑ hatte ihn der Ekel angefasst. Aber schließlich, da seinem Körper die bloße Ausscheidung seiner Abfallprodukte wichtiger gewesen war als zivilisierter Stuhlgang, hatte er vor diesem Hock‑ und Plumpsklo resigniert. Bück’ dich und scheiß’ dir auf die Hacken! hatte er zu sich selbst gemeint, geradeso als wäre nicht er es, der sich hier bücken und auf die Hacken scheißen würde.
Natürlich war es ein Vorurteil in Bezug auf diese spezielle Art einer Toilette gewesen. Schnell hatte er die richtige Technik herausgefunden. Und es dauerte nicht lange, bis er sich nach diesen Hockklos zurücksehnen sollte. Es war in der Bretagne. Er hatte sich von der kleinen, sauberen Pension, in der er ein Zimmer bezogen hatte, entfernt, um die Küste entlang zu fahren. Mitten in so einem Touristen‑Ort ließ sich dann das Bedürfnis nicht mehr weiter zurückhalten. So nahm das Geschehen seinen Lauf, denn das einzige Klo weit und breit war kein Scheiß‑dir‑auf‑die‑Hacken‑Klo, sondern einer jener Orte, an denen Winzkriecher, Bakterien, Mikroteilchen, Fäkalienfresser in Erwartung eines Menschen auf der Kloschüssel Amok liefen.
Diese Toilette war eine Telefonzelle zum Scheißhaus umgebaut, eine ehemalige in zwei Scheißzellen unterteilte Litfasssäule, eine chemische Toilette, und es war noch nicht einmal genug Platz vorhanden, sich vorzubeugen und gebückt stehen zu bleiben ‑ man konnte gar nicht anders, als sich hinzusetzen.
Ein Vorteil der Hock‑ und Plumpsklos war der, dass man quasi in einen Trichter sein Geschäft verrichtete, der in ein kleines Loch mündet. Und wenn die Spülung betätigt war, blieb nur dieses Loch in der weißen Emaille übrig. So klein, so tief unter einem gelegen, dass es die Phantasie kalt ließ. Aber an diesem Tag hatte er ein Loch fast so groß wie sein Hintern unter sich, und darunter war nicht ein Nirwana der Entsorgung. Keinen halben Meter darunter war eine feucht schimmernde, höllisch auch nach Chemie stinkende Masse, ein Hades der menschlichen Ausscheidung. Der Teufel wusste, was für Wesen am Grunde dieser Kloake lebten. Es war ja bekannt, dass man sich vor Angst in die Hosen machen konnte. Ihm aber verkrampfte sich alles. Er saß über der Hölle und konnte sich einfach nicht erleichtern.
Da fiel ihm der Klowandevergreen ein: Ich bin der Geist, der jedem, der zu lange scheißt, von unten in die Eier beißt! Aber in diesen Augenblicken angestrengten Drückens: Bauchpresse! Streng deine Bauchpresse an! fand er diesen alten Witz eigentlich weniger lustig. Warum hatte er sich überhaupt da hingesetzt? Kein Ausweg, das einzige Klo weit und breit. Eine Scheißtouristenfalle ist das, dachte er, und plötzlich in diesen bangen Momenten fielen ihm alle möglichen Gründe für eine Scheißtouristenfalle ein. War das nicht wahr, dass die Franzosen keine Deutschen mochten? Das einzige Klo weit und breit, und er war darauf hereingefallen.
Ich bin der Geist, der Dir in die Eier beißt! Als ob man Klosprüche ernst nehmen konnte. Geist! Du siehst Gespenster, ‑ etwas platschte, platschte unter ihm in die Masse. Er zuckte zusammen. Nur dein eigener Stuhl! beruhigte er sich, nur dein eigener Stuhlgang und kein Geist. Nicht der Geist! redete er sich gut zu und lächelte über seine Überempfindlichkeit: Du siehst Gespenster! Er lachte erleichtert über die endlich erfolgende Ausscheidung und belustigt über seine Unruhe. Ich scheiß‘ Dich tot!, lachte er und dachte doch im selben Atemzug, dass Gespenster unsichtbar sein können, unsichtbar und auch Bakterien sind unsichtbar! und…‑ Ich scheiß‘ dich tot! – tot scheißen lassen sie sich auch nicht…
Mit dem Klopapier, das er dann in diese Hölle hinein warf, ließ er alle Hoffnungen fahren, sich nicht mit irgendwas angesteckt zu haben. Er wusste zwar noch nicht welcher Art der Höllenhund war, welcher ihn an diesem Ort angesprungen hatte, aber als er das Klopapier auf dem Dreck liegen sah, da erschien ihm dies wie ein Grabstein: Weiß der Stein, braun die Inschrift Hier liegt begraben ‑ Mein Frankreichurlaub.
Er hatte sich damals nicht infiziert, was allerdings an seinem Eindruck nichts änderte: zu Hause ist es doch am Besten. Und in diesem Sinn erfreute er sich des gepflegten Stuhlgangs an diesem Abend.
Ende

Obwohl die Winzkriecher-Szene auf Lesungen mit ihrem speziellen Humor immer sehr gut ankam, habe ich sie nicht in die veröffentlichte Fassung meines Romans „Engel spucken nicht in Büsche. Roman über Liebe, Tod und Teufel“ übernommen. „Killing the darlings“, sagte mir damals ein Lektor in Bezug auf die Bearbeitung eines Manuskriptes, löse dich vom Liebgewonnenen und übernehme nur, was für die Geschichte wirklich notwendig ist, und dieses Darling hier sprang aus dramaturgischen Gründen über die Klinge.
Veröffentlicht unter Boschers Schreibe
Verschlagwortet mit Frankreich, Leseproben, Ralf Boscher, Roman
Schreib einen Kommentar
Ein alter Feind neu entdeckt. Die Saat, von Guillermo Del Toro und Chuck Hogan – Rezension

Kennt Ihr das? Ihr lest ein Buch und findet plötzlich einen alten Bekannten wieder? Ich dachte schon, es gäbe ihn nicht mehr. Den bösen Vampir, den alten Feind der Menschheit. Ich dachte schon, diese Art des literarischen Blutsaugers wäre ausgestorben, ersetzt durch nette, sensible Vampire, sehr ansehnlich, gut gebaut, in der Sonne glitzernd, mit guten Umgangsformen.
Aber Pustekuchen. Es gibt sie noch, und was das Wiedersehen erfreulich macht: Sie sind wieder da, die Bezüge zum wirklich Beängstigenden. Unter der Oberfläche der von uns Menschen so fein eingerichteten Welt lauert etwas Mächtiges, was uns alle auslöschen kann. Der alte Hauch von Pestilenz. Der alte Gedanke, dass nur ein dünne Haut zwischen unserer zivilisierten Welt und dem Chaos liegt. Dass jeder von uns im Handumdrehen (und nicht durch eine gewollte romantische Handlung) das, was uns als Menschen ausmachte, verlieren kann. Der Vampir hatte immer etwas von einer Krankheit an sich. Und in „Die Saat“ wurde dieser Gedanke (man denke nur an die Blutbild-Bilder aus Coppolas Dracula) konsequent und in aller Grausamkeit durchgespielt.
Ein sehr spannendes Buch. Hart. Apokalyptisch. Aber nicht ohne Hoffnung. Sei wachsam, sei mitmenschlich, achte auf die Zeichen (und besorge dir richtigen Waffen!). Ein Buch für alle, die „The Stand“ von Stephen King mochten (gerade wenn sie bei allem Mögen sich des Eindrucks einer gewissen Langatmigkeit nicht erwehren konnten und sich ein wenig mehr Action gewünscht haben). Ein Buch für alle, denen es im Zwielicht zu wenig zwielichtig zuging.
Veröffentlicht unter Boscher bespricht
Verschlagwortet mit Horror, Lesetipp, Rezension, Roman, Vampirroman
Schreib einen Kommentar
Erotik und Schreiben… Heute auf der Tagesordnung: eine erotische Szene für den neuen Roman
Heute Abend soll geschehen, was die Woche über nicht geschah. Die Arbeit des Tages, die einen einnimmt – und von der man viel zu viel mit nach Hause nimmt. Der Alltag, der einen beschäftigt. Was ist nicht alles zu tun, zu bedenken. Die Wäsche, die aufzuhängen ist. Die Böden, die gesaugt werden müssen. Und was nicht alles an einem Tag geschieht, das besprochen werden sollte, besprochen wird… Alles wichtig, aber heute, jetzt, alles nichtig, denn nun sollte es gelingen, einfach mal loszulassen. Nicht zu denken. Nichts zu tun. Jedenfalls nichts anderes, als das Eine. Und so soll es heute geschehen.
Wichtig ist, denke ich, die richtige Musik. Ein anregendes Ambiente. Vielleicht ein Glas Rotwein, der dann im Schein der Kerzen warm schimmert. Wichtig ist es, den Tag hinter sich zu lassen. Früher war dies vielleicht anders. Da geschah vieles spontan. Kopf und Herz waren nicht so angefüllt mit Dingen, die erledigt werden müssen. Da ließ man sich einfach mitreißen. Plötzlich war die richtige Stimmung da. Nichts schob sich zwischen dieses spontane Vibrieren und das es tun. Doch heute hängt man erst einmal die Wäsche auf. Erledigt wichtige Anrufe. Erledigt Dinge. Um sich den Freiraum zu schaffen, der sich schwerer nur spontan einstellt.
Doch heute. Nichts mehr zu erledigen. Alle Anrufe getätigt. Der Wein schimmert warmrot im Kerzenschein. Jetzt noch die richtige Musik auswählen. Sade ist sehr passend. Ein Mix aus ihren Stücken und Stücken von Massive Attack. Teardrop und Angel. Ja, das ist gut. Jetzt geht es los. Ich nippe an meinem Glas, der Rotwein wärmt mich. No Ordinary Love hüllt mich ein.
Dann starre ich auf die letzten Zeilen, die ich für meinen neuen Roman geschrieben habe: „Alle Erregung, die sie bis zu diesem Abend erlebt hatte, war gegen die nun ihr Haupt erhebende Gier nur ein handzahmes Schoßhündchen gewesen. Fütter mich, fütter mich! Die Lust tobte wie ein hungriges, wildes Tier zwischen ihren Schenkel. …“
Und nun? Der Kursor blinkt. Fütter mich, fütter mich.
Ich weiß, was ich schreiben möchte. Welche Stimmung ich in dieser Szene erzeugen möchte. Ja, ich sehe die Szene sogar vor mir. Er. Sie. Viele Menschen in der Nähe. Ein Fest. Doch das stört sie nicht, sie lassen sich hinreißen von ihrer Lust aufeinander.
Ich füttere den Kursor mit explizierter Gier. Es reißt mich an der Tastatur hin. Wie feucht sie ist und er hart. Wie sie sich die Jeans herunterzieht und sich beugt und spreizt und er sie nimmt und nimmt und sie sich ihm hingibt. 600 Wörter für 6 Minuten Quickie. Wow. Darauf noch ein Glas Wein.
Doch als der frisch eingeschenkte Wein warm in meinem Glas schimmert, kommen mir, während Massive Attack die dunklen, eindringlichen Klänge von Angel durch meine Boxen jagt, Zweifel. Ist es das, was ich wollte? Sah ich das wirklich vor mir? Charakterisiert diese Sexszene die beiden Hauptfiguren in meinem Roman? Nein.
Gier, ja. Aber explizit?
Ich sollte jedes sechste Wort weglassen, mindestens. Und der Ton trifft es auch nicht. Also lösche ich den Abschnitt und beginne von vorne.
„Die Lust tobte wie ein hungriges, wildes Tier zwischen ihren Schenkel. …“
Und jetzt bitte mehr Sinnlichkeit. Mitreißend. Ein ganz und gar außergewöhnliches erotisches Erlebnis. Nicht per se. Also nicht im Sinne von außergewöhnlichem Sex. Sondern ein tiefgreifendes, die beiden für alle Zeiten verbindendes Erlebnis.
Ich starre auf den Bildschirm. Versuche dieses Bild von den Beiden, dieses Gefühl, dass etwas ganz Besonderes in diesem Moment geschieht, zu fassen – die Worte zu finden, die es fassbar machen. In Gedanken wandert mein Blick zum Fenster, durch welches das helle Licht der Straßenlaterne fällt. Dann wende ich den Blick von Fenster ab und schreibe:
„Sie zog ihn weg vom Licht der Straßenlaterne hinter den erstbesten Busch. Sie…“
Das Fenster sollte auch mal wieder geputzt werden, geht es mir plötzlich durch den Kopf. Ich stehe von meinem Schreibtisch auf und öffne das Fenster. Aber nicht heute. Ich zünde mir eine Zigarette an und blicke auf die Straße hinaus. Ich wusste doch, dass ich etwas vergessen hatte. Am Straßenrand stehen die blauen Papiertonnen. Morgen ist der Abfuhrtermin. Und ich habe unsere Tonne noch nicht gerichtet…
Eine Viertelstunde später kehre ich an meinen Schreibtisch zurück. Die Tonne steht nun an der Straße, ich habe noch schnell einige Kartons eines Versandhauses zerrissen und hineingestopft, dann auf dem Rückweg die Katze gefüttert. Ich lösche den zuletzt geschriebenen Satz, versuche einen Neuen:
„Sie zog ihn weg vom Licht der Straßenlaterne hinein in die Dunkelheit hinter einen Altpapiercontainer. Schnell öffnete sie die Knöpfe ihrer Jeans, nahm seine Hand und führte sie zwischen ihre Schenkel…“
Und nun? Der Kursor blinkt. Fütter mich, fütter mich. 10 Minuten lang schaffe ich kein weiteres Wort.
Hallo Schatz, ich bin wieder da! Meine Liebste ist von ihrem Mädelsabend in Konstanz zurück. Ich lasse den Kursor blinken und begrüße sie. Natürlich hat sie einiges zu erzählen. Immerhin haben wir uns seit unserem Abschied heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit nicht gesehen. Also hole ich meinen Wein vom Schreibtisch, schenke ihr ein Glas ein und wir setzen uns an den Küchentisch. Eine Stunde später bin ich und ist sie halbwegs auf dem Laufenden, was sich Neues ereignet hat. Auf der Arbeit, bei ihr nach der Arbeit beim monatlichen Shoppen mit ihren Freundinnen und anschließendem Absacker. Und wie hat es mit dem Schreiben geklappt?, fragt sie mich, der ich mich seit einigen Minuten im Geiste vom Küchentisch langsam wieder zum Schreibtisch bewege. Diese Szene in meinem neuen Roman liegt mir schließlich schon seit Tagen auf dem Herzen.
Doch bevor ich antworten oder mich Richtung Schreibtisch verabschieden kann, fällt ihr noch etwas ein: Ich habe mir doch ein Kleid gekauft!, strahlt sie mich an, Das muss ich dir doch zeigen! Und da sage ich natürlich nicht nein. Ich liebe Kleider an ihr. Und das neue Kleid – und sie im neuen Kleid – ist wirklich eine weibliche Wucht.
Kleider… ob sie im Roman nicht Jeans, sondern ein Kleid tragen sollte? Einen Moment bin ich hin- und hergerissen zwischen dem Anblick vor mir und dem inneren Bild der Szene aus meinem Roman. Sie nimmt ihn an der Hand, lässt ihn dann los – lehnt sich an den Altpapiercontainer, hebt den Saum ihres Kleides über ihre Knie, höher und höher… Einen Moment. Dann lächelt mich meine Liebste an – auf diese ganz spezielle Weise. Dreht sich um ihre eigene Achse. Gefalle ich Dir in diesem Kleid?, fragt sie. Und: Oh ja!, antworte ich. Denke ich. Fühle ich. Tue ich. Während nebenan der Kursor blinkt. Plötzlich ist vergessen, was am heutigen Freitagabend geschehen sollte. Es zählt nur noch, was geschieht.
„Die Lust tobte wie ein hungriges, wildes Tier zwischen meinen Schenkel. …“
An jenem Abend kehre ich nicht mehr zu meinem Roman zurück. Später in der Nacht, meine Liebste schläft schon, lösche ich die zuletzt geschriebenen Worte und schließe die Datei, fahre den Rechner herunter. Dann gehe ich zu Bett. Warm strahlt unter der Decke zwischen uns die Zärtlichkeit der besonderen Nähe. Lächelnd schlafe ich ein.
Und am nächsten Morgen geschieht es. Früh erwache ich. Wochenende. Das Lächeln beim Aufwachen war ein Echo der Küsse meiner Liebsten. Leise stehe ich auf. Während das Wasser für den ersten Kaffee zu kochen beginnt, spült ich noch schnell die Gläser vom Vorabend. Dann füttere ich die Katze. Leise, um meine Frau nicht wecken, gehe ich mit der Tasse Kaffee in der Hand in mein Arbeitszimmer, fahre den Rechner hoch und öffne meine Romandatei – und dann geschieht es. Keine Musik spielt. Keine Kerzen lassen warm den Wein schimmern. Der heiße Kaffee dampft in der Tasse.
Sie trägt kein Kleid. Ich brauche keine 600 Wörter.
„Sie konnte nicht mehr warten, zog ihn weg vom Licht der Straßenlaterne, zog ihn aus der Menge in die Dunkelheit eines Hinterhofes hinein. Es war eine Offenbarung im Stehen, mit bis zu den Knien heruntergelassenen Jeans. Er gab der Bestie Futter, bis sie sich fürs Erste wohlig gesättigt auf den Rücken drehte, um sich sanft den Bauch kraulen zu lassen.“
Ein guter Anfang für das, was noch kommen soll. Dann gehe ich Frühstück für meine Liebste und mich richten.
Und hier eine Leseprobe, wie es aktuell mit dem hier in der Entstehung beschriebenen Kapitel steht…
Veröffentlicht unter Boschers Streiflichter
Verschlagwortet mit Alltagsgeschichten, Erotik, Roman, Schreiben
Schreib einen Kommentar
Obszön-religiöse Fresken – Clive Barker, Coldheart Canyon – Rezension
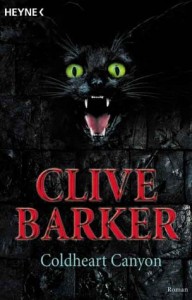
Kennt Ihr das… Ihr hört ein Musikstück und wisst: Diese Töne werden Euch nie wieder loswerden, den ersten Satz von Beethoven Fünfter, die ersten Takte von Dream Theaters „The Spirit Carries On“, Nightwishs „Ghost Love Score“… Ihr lest die ersten Seiten eines Buches und seid gefangen, nein mehr, Ihr wisst, diese Seiten werden Euch immer begleiten. Der Anfang von John Irvings Garp zum Beispiel. Anthony Burgess „Der Fürst der Phantome“. Und die ersten Kapitel von Clive Barkers „Coldheart Canyon“. Die Beschreibung dieser monumentalen, unheimlichen, von düsteren Kräften mit Energie aufgeladenen, obszön-religiösen Fresken. Nur der Anfang, ganz am Anfang von Barkers dickem Wälzer, aber Hallo! Das hat die Qualität seiner „Bücher des Blutes“, vor allem der Titel gebenden Geschichte. Ich bin beeindruckt.
Veröffentlicht unter Boscher bespricht
Verschlagwortet mit Horror, Lesetipp, Rezension, Roman, Spannung
Schreib einen Kommentar
Ein Pub in Clonakilty oder der brennende Engel, John Connolly – Rezension
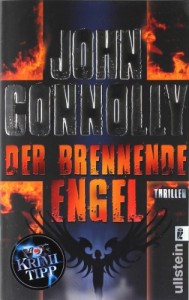
Kennt Ihr das De Barra in Clonakilty (Geburtsstadt des irischen Freiheitskämpfer Michael Collins)? Ein gemütlicher Pub, damals 2001 noch verraucht und meist Freitags der Auftrittsort von Noel Redding (verstorben 2003), ehemals Bassist der Jimi Hendrix Experience. Dort an der Theke des De Barra, einen Tag nachdem ich Noel Redding live gesehen hatte, erzählte mir ein Einheimischer bei einem Guinness (oder zwei) mit hörbarem Stolz in seiner Stimme von einem jungen irischen Schriftsteller. So gut, nein besser wie Stephen King (über den wir ins Gespräch gekommen waren, er hatte Friedhof der Kuscheltiere in meiner Manteltasche gesehen, meine Reiselektüre).
John Connolly würde der junge Ire heißen, seine Romane seien düster, sehr spannend, viel Gewalt, dämonisch ginge es zu. Kurz: Er weckte mein Interesse, und wieder daheim erinnerte ich mich an diesen Buchtipp. Das schwarze Herz. Gekauft. Verschlungen. Das dunkle Vermächtnis. Gekauft, verschlungen. Der Ire im Pub hatte nicht untertrieben (obwohl ich Connolly nicht über King stellen würde): sehr düster geht es in den Romanen zu, die in Charlie Parker eine Hauptfigur haben, die von dunklen Schatten getrieben ist wie kein anderer „Serienheld“, den ich kenne. Getrieben vom Verlust seiner ersten Frau und seines Kindes, von der Rache an den Schuldigen, getrieben vom Bösen, welches ihn, den ehemaligen Cop, jetzigen Privatdetektiv, ob in menschlicher oder dämonischer Form immer wieder findet.
In „Der brennende Engel“ sind es gefallene Engel, die Parker, der wieder einmal von seinen Freunden Angel und Louis, einem Killer, unterstützt wird, umtreiben. Louis‘ Cousine, auf die schiefe Bahn geraten, wird vermisst. Die letzte Spur führt zu einem Zuhälter in New York und in eine Welt, in der es keine Hoffnung zu geben scheint. Eine Welt, in der aus Knochen Kunst geschaffen wird. In der es nur Gewalt zu geben scheint. Schmerz. Tod. In der ein uralte okkulte Gemeinschaft, „Die Gläubigen“ (wirklich fies die Figur des „Brightwell“), das Tor zur Hölle aufreißen wollen, und dabei vor keiner noch so grausigen Tat zurückschrecken, um die von Gott verstoßenen Engel zu erwecken. Eine Welt am Abgrund. Ein Charlie Parker am Abgrund. Düster, wie gesagt, sehr düster. Aber auch sehr lesenswert. Ein okkulter Thriller in ausladenden Dimensionen. Unheimlich. Spannend.
Veröffentlicht unter Boscher bespricht
Verschlagwortet mit Horror, John Connolly, Lesetipp, Rezension, Roman, Thriller
Schreib einen Kommentar
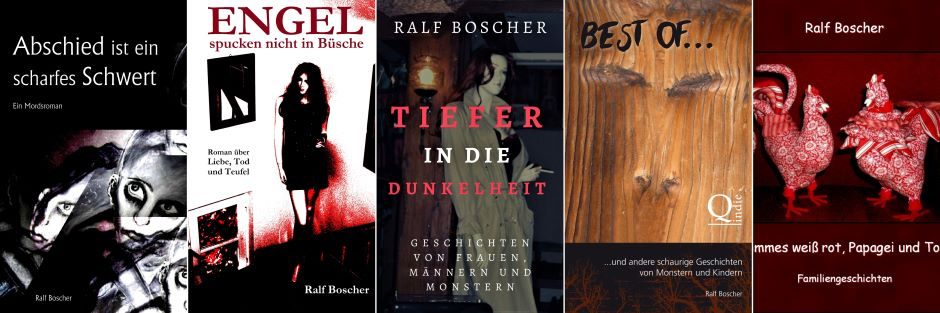





 RSS – Beiträge
RSS – Beiträge